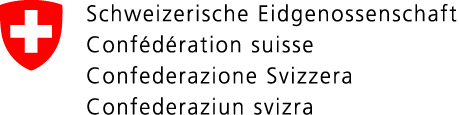Die Bundeskanzlei bereitet in enger Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden beschränkte, praktische Versuche für das elektronische Sammeln von Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden vor.
In der Schweiz werden Unterschriften als Mittel der demokratischen Partizipation und der Wahrnehmung der politischen Rechte gesammelt. Die Abläufe umfassen mehrere Handlungen, die von verschiedenen Akteuren und Akteurinnen ausgehen. Komitees rufen Stimmberechtigte dazu auf, unter Angabe ihrer persönlichen Daten und mit der Erfassung ihrer Unterschrift eine Unterstützungsbekundung für eine Volksinitiative oder ein Referendum abzugeben. Die Unterstützungsbekundungen werden dann an die Gemeinden übermittelt. Die Gemeinden prüfen die Unterstützungsbekundungen und bescheinigen sie, falls die unterzeichnende Person im Stimmregister aufgeführt ist. Die Gemeinden retournieren die Listen an die Komitees, welche sie sammeln und sie gemeinsam an die Bundeskanzlei übergeben. Die Bundeskanzlei prüft die Bescheinigung sowie die Formvorschriften und zählt die Unterstützungsbekundungen zusammen.
E-Collecting bezeichnet ein digitales Verfahren für die Handlungen; sei es die orts- und zeitunabhängige Bekundung der Unterstützung für ein Volksbegehren oder aber die digitale Bescheinigung der Stimmberechtigung respektive die Auszählungen der Listen.
Stand der Arbeiten
Am 20. November 2024 verabschiedete der Bundesrat in Erfüllung von Postulat 21.3607 der staatspolitischen Kommission des Nationalrats den Bericht «Elektronische Unterschriftensammlung für eidgenössische Volksbegehren (E-Collecting)». Der Bericht zeigt die organisatorischen, technischen, rechtlichen und staatspolitischen Chancen und Risiken von E-Collecting auf. Gestützt auf die Ergebnisse des Berichts beauftragte der Bundesrat die Bundeskanzlei, beschränkte, praktische Versuche mit E-Collecting vorzubereiten. Die Versuche sollen dazu beitragen, die Auswirkungen von E-Collecting auf die Nutzung der Volksrechte zu beurteilen. Die Fragestellungen, die im Postulatsbericht identifiziert werden, gilt es bei der Konzipierung zu klären.
In der ersten Jahreshälfte 2025 haben beide Parlamentskammern Motionen angenommen, die einen entsprechenden E-Collecting-Versuchsbetrieb unterstützen.
Die verschiedenen Akteure im Sammelprozess haben unterschiedliche Rollen und tragen die Verantwortung für verschiedene Teile der einzelnen Prüfarbeiten. Auch bei E-Collecting gilt es, die Rollen und Verantwortungen der einzelnen Akteure festzulegen.
Partizipativer Prozess
Die verschiedenen Varianten für die Umsetzung von E-Collecting sollen in einem ersten Schritt erhoben, beschrieben und besprochen werden. Diese Arbeiten bilden die Grundlage für einen behördlichen Variantenentscheid als zweiten Schritt. Im dritten Schritt wird der Variantenentscheid dann umgesetzt und der beschränkte Versuchsbetrieb gestartet. Auch diese Arbeiten sollen im Rahmen des partizipativen Prozesses besprochen und begleitet werden.
Im Juli 2025 lanciert die Bundeskanzlei in Absprache mit den Kantonen den partizipativen Prozess. Der geplante Dialog orientiert sich an der Zusammenarbeit zur Erarbeitung und Einführung der E-ID durch das Bundesamt für Justiz.
Mit dem partizipativen Prozess will die Bundeskanzlei gemeinsam mit Kantonen und Gemeinden, interessierten Akteuren aus Politik und Zivilgesellschaft sowie der Wissenschaft und Fachkreisen die Möglichkeit geben, zur Klärung der vielfältigen offenen Fragen technischer, organisatorischer und rechtlicher Natur beizutragen.
Medienmitteilungen
20.11.2024
Der Bundesrat lässt Grundlagen für praktische Versuche mit E-Collecting ausarbeiten
Der im November 2024 publizierte Postulatsbericht zeigt die die organisatorischen, technischen, rechtlichen und staatspolitischen Chancen und Risiken von E-Collecting auf. Er ist die Basis für die weiteren Arbeiten im Bereich E-Collecting.
23.07.2025
Die Eröffnungsveranstaltung am 27.8.2025 markiert den Start des partizipativen Prozesses zu E-Collecting. Interessierte Stellen und Personen werden dazu eingeladen, sich mit Ideen, Überlegungen, Wünschen, Bedürfnissen und Vorbehalten einzubringen.
Die gemeinsame Erarbeitung von Vorschlägen zu E-Collecting trägt zu einer nachhaltigen Lösung bei, die den Bedürfnissen aller Stakeholder Rechnung trägt.
Für den 31. Oktober / 1. November 2025 kündigt die Bundeskanzlei ferner einen Hackathon an, an dem hauptsächlich technische Lösungen zu fachlichen Herausforderungen erarbeitet und dokumentiert werden sollen. Die Ergebnisse dienen als Diskussionsgrundlage für eine Folgeveranstaltung des partizipativen Dialogs.
Dokumente
- Elektronische Unterschriftensammlung für eidgenössische Volksbegehren (E-Collecting). Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 21.3607 Staatspolitische Kommission NR vom 27. Juni 2021 (PDF, 814 kB, 18.07.2025)
- Rechtsgutachten von Langer, Lehner und Hoffet (PDF, 453 kB, 18.07.2025)
- Politikwissenschaftliche Studie von Bühlmann und Schaub (PDF, 1 MB, 18.07.2025)