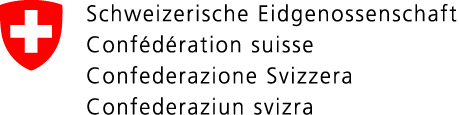Einführung von Bundeskanzler Walter Thurnherr
an der Herbsttagung der Schweizerischen Gesellschaft für
Verwaltungswissenschaften,
13. Oktober 2022 in Bern
«There was nothing inevitable about
Mussolini’s takeover of power»
Ian Kershaw
Anrede
Die Antwort auf die Frage, ob Diktatur oder Demokratie, fällt einem nicht schwer - vor allem dann, wenn man in einer Diktatur gelebt hat. Selbst wer in der Diktatur etwas zu sagen hat, lebt gefährlich, weil er nie weiss, ob er nicht doch gestürzt und dann gehängt wird. Wer hingegen in einer Demokratie lebt, geniesst in der Regel mehr Freiheiten und lebt weniger ungeschützt, und zwar auf allen Stufen. Diktaturen erzeugen auf die Länge weniger Wohlfahrt, und Demokratien finden im Durchschnitt bessere Antworten auf neue Probleme. Darüber hinaus ist das Leben selbst im höchsten Norden Kanadas angenehmer als in Nordkorea, in Irland freier als in Iran, und in Japan sicherer als in Jemen.
Die Antwort auf die Frage, weshalb trotzdem Demokratien immer wieder in Diktaturen enden, oder in autoritäre Regimes abrutschen, die dann in Diktaturen abstürzen, ist etwas weniger offensichtlich.
Es lohnt sich dorthin zu schauen, wo Demokratien auf der Kippe stehen oder gescheitert sind. Und ich meine nicht Russland, wo sich einer mit einem verdrehten Verständnis der Vergangenheit in den Kopf gesetzt hat, das Rad der Geschichte in eine Ära sowjetischer Grösse zurückzudrehen. Russland hatte nie eine richtige Demokratie eingeführt, nur demokratische Formalitäten und provisorische Freiheiten, und auch das nur für eine kurze Dekade, bis Putin dafür sorgte, dass die Medien wieder veröffentlichen mussten, was die Führung wollte und die Gerichte entscheiden durften, was der Kreml sagte.
Ich denke zum Beispiel an das Italien der 1920er Jahre, als Mussolini, jener Autodidakt auf dem Gebiet der heimtückischen Winkelzüge und ruchlosen Machenschaften als jüngster Premierminister seines Landes und zu diesem Zeitpunkt als der jüngste Staatschef der Welt die Macht in Italien an sich riss. Es ist heute auf die Woche fast genau hundert Jahre her, als der sogenannte Marsch auf Rom stattfand, wobei der spätere Duce bekanntlich nicht marschierte, sondern den Nachtzug von Mailand nach Rom nahm, der dann prompt anderthalb Stunden Verspätung hatte (die Geschichte hat ihre Konstanten), was Mussolini nicht daran hinderte, sich im Hotel ein Schwarzhemd überzuziehen und den wartenden König mit den Worten zu begrüssen: «Majestät, ich komme vom Schlachtfeld». Diese Machtübernahme wäre ohne das gewaltige soziale Elend vorangegangener Jahre, zusammen mit den Massen zurückkehrender, verrohter und enttäuschter Soldaten des Ersten Weltkriegs undenkbar gewesen.
Ich denke an die gefährlichen Entwicklungen, die sich seit Jahren in den USA abspielen - dort, wo seit dem 6. Januar 2021 viele Bürgerinnen und Bürger sich geschockt die Augen reiben, aber gleichzeitig ahnen oder wissen, dass es zu einfach wäre, die Verantwortung für die über weite Strecken hasserfüllte, unversöhnliche, labile und erregte Stimmung einzig in einer bizarren Persönlichkeit zu suchen, die nie hätte Präsident werden dürfen. Auch wenn Trumps nihilistischer Spiritus Rector, Steve Bannon, den inzwischen berühmten Satz geprägt hatte: «We didn’t win the election to bring the country together», brauchte es Voraussetzungen, um ein Land so erfolgreich zu spalten, wie das in den letzten Jahren geschehen ist. Und zu diesen Voraussetzungen gehörte eine wachsende, verzweifelte, und verarmte Wählerschaft, denen die Ermahnungen einer abgeschirmten Elite, doch bitte die Verfassung zu respektieren, völlig gleichgültig wurden. Dass Trump nicht wusste, dass Puerto Rico Teil der USA war, dass er keine Antwort auf die Frage geben konnte, ob Kolumbien zum süd- oder zum nordamerikanischen Kontinent gehörte, dass er dachte, Finnland sei ein Teil Russlands, dass er das Baltikum mit dem Balkan verwechselte, und dass er über fast keine Ahnung verfügte, wie der Staat, die Gerichte oder die Gewaltenteilung überhaupt funktionierten – «How do I declare war?» soll er einmal seinen aufgeschreckten Stab gefragt haben, offenbar hatte ihm niemand mitgeteilt, dass der Kongress hierfür zuständig ist – all das, war (und ist) einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung völlig egal, solange er die Eliten angriff, und das Bestehende einzureissen versprach.
Ich denke an verschiedene Orte und Phasen der europäischen Geschichte, in denen stets dieselben drei Faktoren bestimmend waren, als Demokratien scheiterten - und vielleicht wieder bestimmend werden, wenn man nicht aufpasst: Erstens, ein verbitterter und wütender Teil der Wählerschaft, oft der Mittelklasse, ohne Hoffnung und Zuversicht. Zweitens, eine radikale Minderheit, die die Möglichkeit erkennt, das Land zu retten oder sich selber an die Macht zu bringen. Und drittens, eine passive Mehrheit, die nicht mehr bereit ist, für die Freiheiten und die Rechte in einer Demokratie zu kämpfen.
Dass die Schweiz bisher von einer solchen Entwicklung verschont blieb, hat weniger mit einem besonders geglückten staatspolitischen Unterricht in allen Kantonen zu tun, auch nicht mit spezifischen, den Eidgenossen vorbehaltenen genetischen Vorteilen oder mit dem genialen Weitblick aussergewöhnlicher Führungspersönlichkeiten, und schon gar nicht mit durchdachten Legislaturplanungen, die hierzulande bekanntlich in erster Linie einen buchhalterischen Zweck erfüllen, sondern im Gegenteil mit einer äusserst flexiblen Entwicklungsfähigkeit unserer Verfassung, bzw. unserer Demokratie, die seit 1874 schrittweise direkter, heute würden wir sagen «partizipativer» wurde. Denn Referenden und Initiativen haben die politische Schweiz nicht nur gebremst und gestossen. Das haben Regierung und Parlament auch. Diese beiden Instrumente, Referendum und Initiative, waren deshalb so revolutionär, weil sie allen mit Stimmrecht die Möglichkeit gegeben haben, selber korrigierend einzugreifen. Ein Volksrecht wurde zu einem wirkungsvolleren Hebel als jede gutplatzierte Bombe im Keller des Parlamentsgebäudes. Und mancher Streit konnte damit entschärft werden, bevor er explodierte. Partizipative Demokratie ist eine gute Sache. Wir haben sie nicht erfunden. Aber wir haben sie seit langem wirksam eingesetzt.
Die Digitalisierung eröffnet dabei neue Möglichkeiten, weist aber gleichzeitig auf neue und alte Grundsatzfragen hin. Zum Beispiel: Wie viel Partizipation soll es denn sein? Technisch gesehen wäre es möglich, die Schlussabstimmungen des Parlaments am letzten Sessionstag jeweils der Bevölkerung vorzulegen, die Nachfolgerin, bzw. den Nachfolger von Bundesrat Ueli Maurer vom Volk wählen zu lassen, die Bundesrichter auch, und wenn es sein muss, selbst den Bundeskanzler. Wir haben in Volksabstimmungen schon über das Salär von Botschaftern entschieden, oder über den Fähigkeitsausweis im Schuhmacher-, Coiffeur-, Sattler-, und Wagnergewerbe. Warum denn nicht gleich die Bundesratsentscheide auf Verordnungsstufe? Zumindest jene, die sich auf Artikel 7 des Epidemiengesetzes oder Artikel 32 des Landesversorgungsgesetzes abstützen, so wie das in den gegenwärtigen Krisen der Fall war und ist. Will man das, weil es technisch machbar ist, oder ist Demokratie noch etwas mehr als eine permanente Rückkopplung mit der momentanen Stimmung im Land?
Darüber hinaus: Welche Partizipation wünschen wir uns? Die Bevölkerung als Ideen-Lieferant, Informant und Hindeuter, wo und was zu reparieren, bzw. zu verbessern wäre? Als atomisiertes Aktionariat, das zu allerlei Vernehmlassungen konsultiert wird? Oder als digital ausgerüstete Politikerinnen und Politiker, die ergänzend zum, oder stellvertretend für das Parlament auf Plattformen Debatten austragen, einander rechtgeben oder entsetzlich beschimpfen?
Partizipation ist nicht gleich Partizipation. Befragen Sie die Bevölkerung zwei Tage nach einem tragischen Unglück – ein Hund beisst einem Kind ins Gesicht, ein Wolf reisst eine Kuh, ein Bungee jumping Seil ist länger als die Fallhöhe – und befragen Sie dieselbe Bevölkerung zwei Monate später. Sie werden zwei völlig verschiedene Rückmeldungen erhalten. Entschleunigung macht in der Regel nicht dümmer. Auf der anderen Seite lassen sich mit der Digitalisierung demokratische Prozesse genau dort beschleunigen, wo man sich bis anhin über die Trägheit und Langsamkeit der Abläufe aufgehalten hat. Wo wollen Sie also welche Partizipation mit welchen Geschwindigkeiten?
Oder andere Frage: Sie können digital ohne Weiteres 100'000 Gleichgesinnte finden, wenn es sein muss, innert Tagen. Soll deshalb die Mindestzahl für Unterschriften bei einer Initiative angepasst werden? Weshalb nur E-Collecting für Referenden und Initiativen, wenn es so einfach scheint (was es nicht ist, denken Sie zum Beispiel an die Sicherheit), warum nicht auch für Initiativen auf Gesetzesstufe? Und so weiter.
Partizipieren hat etwas Verbindendes und Identitätsstiftendes. Man fühlt sich ernstgenommen und ist schon deswegen bereit, sich als Bürgerin und Bürger zu verstehen und nicht nur als steuerzahlender Konsument. Aber der Staat muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Partizipation gelingt. Bildung auf allen Stufen gehört dazu. Eine Medienlandschaft, die die politische Meinungsbildung sicherstellt, gehört dazu. Die Garantie der Grundrechte, insbesondere akzeptabler Lebensbedingungen, gehört dazu. Die Regulierung der sozialen Medien gehört vielleicht auch dazu.
Sie sehen, es gibt zahlreiche Fragen, die man diskutieren kann, wenn von partizipativer Demokratie die Rede ist, und ich bin dankbar, dass wir eine Reihe kompetenter Persönlichkeiten haben gewinnen können, einige dieser Fragestellungen an der diesjährigen Herbsttagung der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften zu erörtern.
Meine Damen und Herren, vor über 20 Jahren stellte Ralf Dahrendorf in westlichen Ländern eine Unzufriedenheit fest, die damit zusammenhing, dass man Erreichtes und Errungenes für selbstverständlich hielt und deshalb nicht mehr schätzte: «Sogar die Demokratie war vielleicht am schönsten», schrieb er 2001, «als ihre noch groben Instrumente benutzt werden konnten, um sie zu vervollständigen, also das Wahlrecht auf alle Bürger und Bürgerinnen auszuweiten und die Kontrolle der Mächtigen zu stärken. Wenn wir erreichen, was wir erstreben, setzt eher Ermattung und sogar eine gewisse Enttäuschung ein». Heute gibt uns die Digitalisierung die Gelegenheit, nicht nur über technologische Möglichkeiten, neue Infrastrukturen und über grössere Geschwindigkeiten bestehender Prozesse zu spekulieren, sondern über die Frage nachzudenken, welche Demokratie wir uns eigentlich wünschen. Welche Gefässe wollen wir stärken, damit Unzufriedenheit früh erkennbar und bekämpfbar wird? Damit noch mehr sich noch besser einbringen können, und damit Zuversicht ein Durchschnitt bleibt, und nicht zum Privileg weniger Glücklicher wird.
Demokratien sind alles andere als selbstverständlich. In vielen Ländern wird wieder eine starke Hand gefordert, die himmelschreiende Missstände bekämpfen oder den angeblich drohenden Abstieg und Verfall abwenden soll. Die Geschichte lehrt uns, dass das in der Regel nicht gut kommt. Im besten Fall können solche «strong men» wieder abgewählt werden, im schlimmsten Fall beginnen sie einen Krieg und werden danach, wie damals in Italien, vom Widerstand erschossen. Als vor hundert Jahren der Marsch auf Rom stattfand, schrieb der amerikanische Botschafter in seinem Bericht für Washington: «Wir erleben hier eine schöne Revolution junger Menschen. Keine Gefahr, wir haben einen Mordsspass». Heute wissen wir, dass wir besser aufpassen müssen. Es kann vieles schnell anders werden.
Ich danke allen, die mitgeholfen haben, diese Tagung zu organisieren, allen voran Professorin Caroline Brüesch und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der neuen Geschäftsstelle und dem Generalsekretär dieser Gesellschaft, Lukas Gresch. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen interessanten Tag und gebe das Wort gerne weiter.