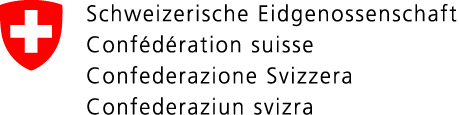Digitale Demokratie: Kein einfaches Ziel. Einige Bemerkungen, bevor man diese politische Reise antritt.
Bern, 28.04.2021 - Rede von Bundeskanzler Walter Thurnherr anlässlich der Vernissage der Ausstellung «Digitale Demokratie – eine Reise in die politische Zukunft» im Polit-Forum Bern
Der Begriff der «digitalen Demokratie» wird weder einheitlich definiert, noch wird er einmütig bewertet. Ganz im Gegenteil, es fliegen schnell die Fetzen: Hier steht er für die überfällige Stärkung der politischen Partizipation. Dort ist er ein Sammelzeichen im Kampf um die bewährten analogen Errungenschaften. Den einen ist die Digitalisierung ein willkommenes Werkzeug, den anderen ein unkontrollierbarer Gräuel. «Hände weg», rufen die Gegner, «unsere direkte Demokratie braucht keinen elektronischen Firlefanz». «Macht einmal vorwärts Ihr verstockten Trotzköpfe», antworten die anderen.
Wer in diesem Umfeld eine Reise «in die politische Zukunft» antreten will, wie es im Titel dieser Ausstellung heisst, tut gut daran, sich einigen grundsätzlichen Fragen zu stellen. Der Ort hier scheint geeignet: Schon in manchem Käfigturm hat eine politische Reise begonnen – oder geendet. Im Parlamentsgebäude nebenan herrscht oft die kurzfristige Perspektive. Wo, wenn nicht hier im Käfigturm, wo gezwungenermassen über eher längerfristige Fragestellungen gegrübelt wurde, ist es passender, über die Voraussetzungen nachzudenken, die erfüllt sein müssen, bevor man von der digitalen Demokratie in der Zukunft zu schwärmen beginnt.
Ich zähle nur vier Fragestellungen auf:
Erstens: Wollen wir die Digitalisierung in der Verwaltung überhaupt, oder tun wir nur so?
In den letzten Monaten ist es ja schon etwas aufgefallen, wie viele Digitalisierungsexpertinnen und -experten wir in der Schweiz haben, die genau wissen, wie man die Bundesverwaltung wieder in Schuss bringt. Ihre Aussagen erinnern mich jeweils an jenen amerikanischen Komiker, der seine Einführung zu Beginn der Show mit der Feststellung abschloss: «What the world needs is more geniuses with humility, there are so few of us left». Seit einigen Jahren werden ziemlich widersprüchliche Forderungen gleichzeitig erhoben. Und man müsste sich heute nicht öffentlich wundern, dass es bei der Digitalisierung in der Bundesverwaltung da und dort klemmt (im Übrigen nicht überall), wenn man in der Vergangenheit etwas dafür getan hätte, diese Widersprüche zu glätten: Jede digitale Anwendung soll bekanntlich schnell, billig und ohne Bürokratie realisiert werden. Und sie soll bitte von Anfang an perfekt sein. Alle reden von mehr E-Government gegenüber den Bürgern und der Wirtschaft, aber wehe der Bund würde einmal einen Software- Standard in allen Kantonen für verbindlich erklären wollen. Alle reden von Fehlerkultur, aber es soll sich ja kein Amt trauen, die Kosten oder die Termine zu überschreiten. Die Aufsichtsgremien sorgen sehr schnell dafür, dass entsprechende Fehler gerügt werden. Und jene Amtsdirektoren, die sich hier versündigen, werden dann öffentlich vorgeführt.
Sie kennen bestimmt jene Fragen, die früher an Radio Erewan gerichtet und stets mit demselben Satz: «Im Prinzip ja» beantwortet wurden: Frage an Radio Erewan: Stimmt es, dass Michail Sergejewitsch einen blauen Lada gewonnen hat? Antwort: «Im Prinzip ja. Aber er war nicht blau, sondern rot. Und es war nicht Michail Sergejewitsch, sondern Pavel Andrejewitsch. Es war auch kein Lada, sondern ein Fahrrad. Und er hat es nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen».
So ungefähr ist es zurzeit, wenn man nach der Digitalisierung fragt. Im Prinzip sind wir sogar sehr dafür. Aber es braucht eine spezialgesetzliche Grundlage. Und das System muss noch diese oder jene Anforderung erfüllen. Und es darf nicht von diesem, sondern soll von jenem Unternehmen betrieben werden. Und, und, und. Und wer das nicht glaubt, soll sich einmal in die Geschichte des elektronischen Patientendossiers vertiefen oder sich noch einmal die E-ID-Abstimmungskampagne anschauen. Man muss nicht alles akzeptieren, nur weil es digital daherkommt, ganz im Gegenteil. Aber wenn wir damals die Eisenbahn so eingeführt hätten, wie wir heute die Digitalisierung diskutieren, dann hätten wir wahrscheinlich bis heute keinen öffentlichen Verkehr.
Was wir brauchen, ist mehr projektbezogene Arbeit. Mehr Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, nicht weniger. Mehr resultatorientierte Digitalisierung statt vor allem prozessorientierte Programmführung. Mehr Prototypen, die laufend verbessert werden können, statt nur Kritik, wenn einmal etwas schiefgeht. Und etwas mehr Druck auf einheitliche Software-Standards, statt jede kantonsübergreifende Anwendung mit dem Streitross des Föderalismus anzugreifen. Kurz, wer von der digitalen Demokratie spricht, muss zuerst klären, wie viel Digitalisierung überhaupt gewünscht wird.
Zweitens: Gesetzt den Fall, wir könnten digitalisieren, was wir wollten: Welche (digitale) Demokratie wollen wir denn?
Es gibt Elemente, die sind unbestritten oder wenig bestritten, etwa im Bereich «Civic Tech». Wir sind zum Beispiel daran, ein neues Datenmodell zu entwickeln, das es allen Bürgerinnen und Bürgern erlauben soll, politische Geschäfte über den ganzen Policy-Zyklus hinweg, von den ersten Vorstössen oder Beschlüssen des Bundesrates über die Vernehmlassung und über die parlamentarischen Beratungen und allfälligen Volksabstimmungen bis zur Umsetzung hin zu verfolgen . Oder wir prüfen die Digitalisierung und Vereinfachung des Vernehmlassungsverfahrens. Oder wir prüfen eine Publikationsplattform für Petitionen. Bund und Kantone wollen darüber hinaus weitere digitale Interaktions- und Partizipationsangebote fördern, insbesondere auf kommunaler und kantonaler Ebene. Auf der Website der «Digitalen Verwaltung Schweiz» (DVS) werden eine ganze Reihe solcher unterstützter E-Partizipationsprojekte vorgestellt. So weit so gut. Aber schon, wenn wir zu E-Voting kommen, scheiden sich die Geister. Hier leben wir immerhin schon seit 17 Jahren im Versuchsbetrieb. Abgesehen davon, dass die potenziellen Betreiber bis anhin die zugegebenermassen hohen Sicherheitsanforderungen des Bundes nicht erfüllen konnten, finden viele bis heute, dass E-Voting keine Erweiterung der Demokratie sei, sondern eine Belastung. Oder nehmen sie das E-Collecting. Auch hier stellen sich Fragen der Sicherheit: Mit welchen Schutzvorkehrungen wird sichergestellt, dass die Dateien mit den Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden nicht gehackt werden können? Oder es dürfte die Frage nach den Quoren gestellt werden: Braucht es für E-Collecting nicht höhere Schwellen als die heute geltenden 50 000 bzw. 100 000 Unterschriften? Schliesslich haben wir bereits mit den bestehenden Möglichkeiten, elektronisch Unterschriften zu sammeln, in Zeiten von Corona festgestellt, dass sehr schnell sehr viele Unterschriften mobilisiert werden können. Darüber hinaus: Unsere demokratischen Verfahren sind geprägt von einer bewusst auferlegten Langsamkeit, die dazu führt, dass sich die Gemüter abkühlen und man sich die Sache zwei, oder noch besser drei Mal überlegt, statt in der unmittelbaren und allgemeinen Aufwallung der Gefühle einen Entscheid zu fällen, der zwar von der Mehrheit getragen, aber bald danach von allen bereut wird. Direkte Demokratie ist schliesslich mehr als das Versprechen, die Bevölkerung laufend zu allen möglichen Fragestellungen zu konsultieren. Oder nehmen Sie die Erläuterungen des Bundesrates zu den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen, das «Abstimmungsbüchlein»: Soll es bleiben, was es ist, nämlich im Wesentlichen eine sachliche Information über die anstehenden Abstimmungsvorlagen, oder soll es eine digitale Plattform werden, auf der sich alle mit allen möglichen Hinweisen oder Meinungen präsentieren und widersprechen sollen? Oder nehmen Sie die App «Vote Info»: Sind Sie der Meinung, der Bundesrat soll nur die Abstimmungsresultate der nationalen Volksabstimmungen und die Resultate der kantonalen Vorlagen auf seiner App veröffentlichen, oder soll er ab Mittag auch erste Hochrechnungen aufschalten? Und so weiter und so fort. Die Digitalisierung erlaubt vieles, und es lohnt sich meines Erachtens, die Sache vom anderen Ende her zu überlegen: Welche Demokratie wünschen wir uns, und wie kann uns die Digitalisierung dabei helfen, dorthin zu gelangen? Sonst werden, wie zum Teil in der Geschäftswelt oder in der Verwaltung, dieselben Dinge gemacht wie vorher, einfach elektronisch statt auf dem Papier oder per Telefon und das mit Nebenwirkungen, die uns erst bewusst werden, wenn es zu spät ist.
Drittens: Wenn wir digitalisieren wollen, und wenn wir wissen, wofür wir die Digitalisierung einsetzen wollen: Wie schaffen wir das dafür notwendige Vertrauen?
Und zwar nicht mit der ungeduldigen, leicht gereizten Attitüde des Besserwissers, der nicht verstehen kann, weshalb die retardierte Bevölkerung die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt hat. Ich meine, wir hören täglich von neuen Cyberattacken, von fehlerhafter Software, von Zero-Day-Handel, von WannaCry und Solar Winds, von Erpressungen, Diebstählen und beeinflussten Wahlen. Und wir vermuten – wahrscheinlich zu recht –, dass noch viel mehr in den Dunkelkammern der Cyberwelt geplant, gemacht und gehandelt wird, von dem wir nichts hören. Wer will es da jenen verdenken, die verunsichert sind. In verschiedener Hinsicht hat sich die Wahrnehmung verstärkt, ein wesentlicher Teil dessen, was wir «Digitalisierung» nennen, sei der politischen Kontrolle entglitten. Unter diesen Umständen ist es meines Erachtens am besten, Vertrauen mit Transparenz zu schaffen, mit dem Einbezug der Öffentlichkeit, der Wissenschaft, mit nachvollziehbaren, iterativen Prozessen, statt mit riesigen Projektankündigungen. Wir müssen darüber hinaus die Abhängigkeiten vermindern, die mit der Digitalisierung entstehen. Heute sprechen alle über das Coronavirus. Aber stellen Sie sich einmal ein ausser Kontrolle geratenes Virus im Netz vor, das unsere kritischen Infrastrukturen, etwa im Strombereich, angreift. Sind wir genügend darauf vorbereitet?
Vertrauen schafft man, indem man nicht zu viel verspricht. Sie kennen vielleicht die wunderbare Biographie von Roy Jenkins über Winston Churchill. Dort gibt es eine Stelle, wo er über den Premierminister schreibt: «He lived in a constant danger of his policy being made by his phrases rather than vice versa.» Auch das sollten sich einzelne Programmverantwortliche in diesem Bereich vornehmen. Digitalisierungsprojekte sind oft komplexer und teurer, als man anfänglich meint. Darum: Nur ankündigen, was man auch zu bauen können glaubt!
Auf der anderen Seite schafft man kein Vertrauen, wenn man glaubt, jeder Verschwörungstheorie Verständnis entgegenbringen zu müssen. Wenn die 5G- Infrastruktur auch noch schuld an der Covid-19-Seuche sein soll, muss man halt auch einmal abwinken können.
Kurz: Nicht jeder, der bei allen Digitalisierungsprojekten mit einem ernsten Gesicht Bedenken anmeldet, ist schon deshalb ein Experte. Aber es sind auch nicht alle Bedenken grundlos, nur weil sie von einem Aussenseiter oder Laien formuliert werden. Die Demokratie ist ein System, das jenen Entscheid zu ermitteln versucht, den die Mehrheit zu tragen bereit ist. Und diese Mehrheit lässt sich nur finden, wenn ein Vertrauen da ist.
Schliesslich, vierte Frage: Wie gestalten wir denn «die digitale Demokratie», wenn wichtige Leitplanken gar nicht in der Schweiz gesetzt werden?
Wesentliche Aspekte der Digitalisierung werden in anderen Ländern oder international reguliert und sind damit gerade nicht das Resultat einer demokratischen Entscheidfindung in der Schweiz. Welcher Datenschutz wird angewendet? Welche Sicherheit wird garantiert? Welche Vorgaben der Meinungsäusserung gelten in den sozialen Medien? Welche Ansprüche müssen Algorithmen erfüllen, falls sie zertifiziert werden? Welche Zugangsbedingungen an die Clouds (Gaia-X) müssen erfüllt sein? Und so weiter. Es ist in den letzten Wochen und Monaten im Zusammenhang mit der Europapolitik sehr oft vom drohenden Souveränitätsverlust die Rede gewesen. Hier in diesem Bereich haben wir die Selbstbestimmung über entscheidende Teile der Digitalisierung längst verloren, und zurzeit geschieht international unerhört viel: in Brüssel, letzte Woche wieder zu AI, in Genf an der UNO im Bereich Völkerrecht und Cybersecurity, in Paris und Washington zu Fintech. Und so weiter. Meines Erachtens müssen wir uns international gut vernetzen, wenn wir unsere eigene Digitalisierung mitregulieren wollen. Andernfalls regulieren die anderen für uns.
Man kann den eigenen Handlungsspielraum auch vergrössern, wenn man die Technologie besser kennt. Weshalb nicht mehr und enger mit den ETH, den Universitäten und Fachhochschulen zusammenarbeiten, um eigene, massgeschneiderte, sichere Produkte zu schaffen? Genauso wie in der analogen Demokratie sollte die digitale Demokratie ein Regelwerk ermöglichen, dessen Feinmechanik wir selber verstehen, selber gestalten und selber betreiben können. Wir könnten das. Wir haben einige sehr innovative Unternehmen und ausgezeichnete Expertise in unseren Forschungsinstitutionen. «Ein Buch ist ein Spiegel – wenn ein Affe hineinsieht, so kann kein Apostel herausschauen», meinte einmal Lichtenberg. Bei der Digitalisierung ist das ähnlich. Man muss etwas mit ihr anzustellen wissen. Sie kommt nämlich so oder so. Es geht mehr darum, sie auch klug zu nutzen.
Meine Damen und Herren, das sind nur vier Fragen. Es gäbe noch mehr: Wie gestalten wir die Meinungsbildung in unserer direkten Demokratie, wenn die Zeitungen aufgrund der Digitalisierung aussterben? Wie gestalten wir die Gesetzgebung für die Digitalisierung, wenn Technikentwicklung und demokratische Entscheidfindung zwei völlig andere Geschwindigkeiten haben? An dieser Ausstellung hier werden noch weitere wichtige Fragen gestellt.
Die Basis für die analoge Demokratie wurde 1848 zweihundert Meter entfernt von hier, im Äusseren Stand, in 51 Tagen ausgehandelt. Die Verfassung war von Anfang an darauf ausgelegt, weiterentwickelt zu werden. Ihre Väter, so schrieb Bonjour später, hätten eben weniger an ihre Vorfahren und mehr an ihre Nachfahren gedacht. Und die Verfassung hat sich verändert: Das Referendumsrecht kam 1874 dazu, das Initiativrecht 1891, die Frauen erhielten vor 50 Jahren das Stimm- und Wahlrecht, und auch die Auslandschweizer dürfen seit 1992 aus dem Ausland mitbestimmen. Das voraussetzungslose briefliche Stimmrecht wurde 1994 eingeführt, und seit 2004 haben wir sogar die gesetzliche Grundlage für das E-Voting im Versuchsbetrieb.
Wie gesagt: Der Begriff der «digitalen Demokratie» wird weder einheitlich definiert noch wird er einmütig bewertet. Ganz im Gegenteil, es fliegen schnell die Fetzen. Aber das ist auch gut so. Es soll eine Debatte stattfinden. So werden wir nicht nur etwas klüger, sondern so entwickeln wir unsere Demokratie auch weiter. Diese Ausstellung ist eine gute Möglichkeit dafür!
Adresse für Rückfragen
Kommunikation
Bundeshaus West
CH-3003 Bern
+41 58 462 37 91
Herausgeber
Bundeskanzlei
http://www.bk.admin.ch